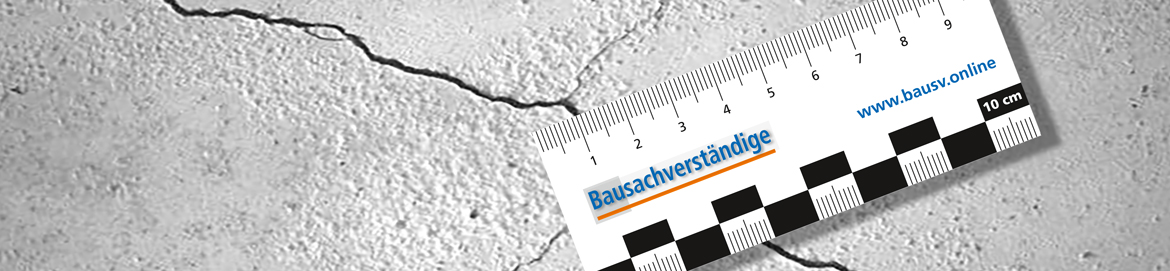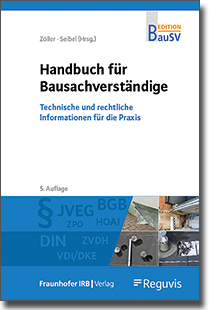Leserbrief zum Artikel von Klaus Arbeiter: »Allgemein anerkannte Regeln der Technik und Regelwerke«
In: Der Bausachverständige Heft 6/2023, S. 34–38
Im Beitrag des ö.b.u.v. Sachverständigen für das Stuckateur-Handwerk der Handwerkskammer zu Köln, Herrn Architekt Klaus Arbeiter, werden Thesen vertreten, die bei Lesern den Schluss zulassen, in Teilen des handwerklichen Sachverständigenwesens würde Lobbyarbeit vom Verbandswesen über die Normenarbeit bis in den Gerichtssaal gepflegt. Dem möchte ich entschieden entgegentreten.
Nach Studium der Sachverständigenordnung der Handwerkkammer zu Köln komme ich zum Schluss, dass diese die gleichen Pflichten der ö.b.u.v. Sachverständigen enthält wie die meiner Bestellungskammer in Unterfranken: »Der Sachverständige hat seine Aufgaben unabhängig, weisungsfrei, persönlich, gewissenhaft und unparteiisch zu erfüllen und seine Gutachten in diesem Sinne nach bestem Wissen und Gewissen zu erstatten.« Wie kommt nun der SV Arbeiter zu einer anderen Auffassung der Ausübung der Sachverständigentätigkeit als ich?
Im Handwerk finden gegenüber anderen Bestellungsorganisationen die Sachverständigentätigkeiten in einem besonderen Umfeld statt. Es bestehen teilweise enge Bindungen an die Kreishandwerkerschaft, Innung, übergeordnete Verbände, Fachausschüsse usw. Die Übernahme einer Funktion als Obermeister oder Dozent in einer Bildungsstätte stellt eine Herausforderung im Hinblick auf die Objektivität, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit dar. Fachverbände verfolgen in Normengremien u.a. die wirtschaftlichen Interessen ihrer Handwerks-Mitglieder. Ö.b.u.v. Sachverständige, welche an solchen Zielen mitwirken, sind gehalten, mehrere Identitäten aufzubauen, wenn sie weiterhin eine gewissenhafte, unabhängige und weisungsfreie Sachverständigentätigkeit gemäß dem geleisteten Eid verfolgen. Es sind daher u.a. folgende Grundanforderungen an ö.b.u.v. Sachverständige im Handwerk zu stellen: »… die Freiheit von starken Bindungen in der beruflichen Sphäre und von wirtschaftlichen Abhängigkeiten«.[1]. Die Unterstützung intensiver Lobbyarbeit, um Normeninhalte in die Breite zu tragen, dürfte nicht zu den Aufgaben ö.b.u.v. Sachverständiger gehören.
Dass technische Regeln (Normen) demokratisch legitimiert sind – wobei im gleichen Satz konstatiert wird, »da sie den von interessierten Kreisen festgelegten Mindeststandard darstellen« –, dürfte Juristen schwer aufstoßen.
Der § 633 BGB formuliert u.a. Anforderungen wie »vereinbarte Beschaffenheit«, »gewöhnliche Verwendung« und »Bestellererwartung«. Dies meint geradezu nicht die Erwartung von Lobbyverbänden sowie angehörigen Sachverständigen an ein Werk!
Dass der SV Arbeiter im von ihm »betrauten« Umfeld sich durchzusetzen scheint und er sich in nunmehr fast 20 Jahren gutachterlicher Tätigkeit nur zwei Mal mit Abweichungen von Normen oder Regelwerken beschäftigen musste, bei denen organisierte Betriebe tätig waren, zeugt von ausgeklügelter Lobbyarbeit, nur: Ist dies Aufgabe ö.b.u.v. Sachverständiger? Meine Erfahrung ist eine ganz andere: Jahr für Jahr gehen Gebäude in Betrieb, bei denen viele Normen nicht eingehalten werden. Die Gebäude sind trotzdem sicher und funktionieren. Heißt im Umkehrschluss: Viele Regelwerke sind überflüssig, sind allenfalls Ausstattungs-, Verbrauchs- oder Verschwendungsnormen.
Es ist zudem überhaupt nicht Aufgabe von ö.b.u.v. Sachverständigen, in etwaigen Netzwerken rechtliche Bewertungen einzupflegen, ob eine Norm den a.R.d.T. entspricht. Es ist aber – entgegen der Meinung des SV Arbeiter – geradezu die ureigene Aufgabe von ö.b.u.v. Sachverständigen, herauszuarbeiten, ob eine technische Regel einer wissenschaftlichen Lehrmeinung entspricht. Wo kämen wir hin, wenn Sachverständige wie dressierte Affen lediglich Abweichungen von ausgeführten Arbeiten gegenüber Normen festzustellen haben, die sie möglicherweise noch selbst mitformulierten? Was ist, wenn der Errichter einer Bauleistung für einen speziellen Anwendungsfall eine Methode angewandt hat, die alle technischen Anforderungen sowie Bestellererwartungen erfüllt? Ist diese Methode nur deswegen fehlerhaft, da sie der vom Sachverständigen favorisierten Norm nicht entspricht?
In den Grundsätzen für das Anwenden von DIN-Normen[2] ist u.a. vorgesehen, dass
- die Norm nicht die einzige, sondern nur eine Erkenntnisquelle für technisch ordnungsgemäßes Verhalten im Regelfall ist,
- das Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit sich nicht für das Befriedigen von Höchstansprüchen eignet,
- sich das Anwenden der Norm wider besseres eigenes Wissen verbietet (z.B. wegen einer fehlerhaften technischen Angabe in einer Norm).
Es bleibt zu hoffen, dass sich im handwerklichen Sachverständigenwesen ein anderes Pflichtbewusstsein im Sinne der Sachverständigenordnungen durchsetzt. Es sind genau diese Entgleisungen der Grund gewesen, in 2019 das »Würzburger Symposium: Sachverständige im Handwerk« zu initiieren: den Sachverständigen im Handwerk eine andere Erkenntnisquelle anzubieten als die Klüngelumgebung der Lobby-Verbände.
Mit dem Artikel des SV Arbeiter wurde dem handwerklichen Sachverständigenwesen ein Bärendienst erwiesen. Gerade handwerkliche Sachverständige genießen den guten Ruf, nicht an Buchstaben von Normen kleben zu müssen, da sie durch die abgeschlossene Handwerksausbildung, Meisterabschluss und mehrjährige Tätigkeit über eine besondere Sachkenntnis mit tiefem Praxisbezug verfügen. Dies verschafft ihnen auch die notwendige Akzeptanz gegenüber ihren Berufskollegen.
[1] Haas: Der Sachverständige im Handwerk, 5. Aufl. 2001
[2] https://www.beuth.de/resource/blob/82394/83a19d5d513195635ae951c975c709d0/anwenden-von-din-normen-data.pdf
Martin Schauer von der Handwerkskammer für Unterfranken, ö.b.u.v. Sachverständiger
im Elektrotechniker-Handwerk und elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder
Leserzuschrift zu den Artikeln von Mark Seibel: »Mangelhafte Bauleistung und technische Regelwerke« sowie Florian Herbst und Julian Dubois: »Gedanken über das Bauproduktenrecht der Zukunft«
In: Der Bausachverständige Heft 4/2023, S. 55 ff. und 50 ff.
Zwei juristische Abhandlungen über die Begriffe der allgemein anerkannten Regeln der Technik und den Stand der Technik, über CE und Ü-Zeichen, bestätigen einmal wieder die Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Juristen und technischen Sachverständigen. Das fängt damit an, dass Juristen immer noch die technische Soll-Beschaffenheit eines Bauwerks anhand von Normen diskutieren, die sie für interpretationsbedürftig halten, und den Sachverständigen DIN-Gläubigkeit vorwerfen. Das kann nur zu Missverständnissen führen.
Zahlreiche europäische Normen beschreiben nicht, wie ein Bauprodukt beschaffen sein soll, sondern wie ein Bauprodukt zu beschreiben ist. Zum Beispiel die europäische Norm für Fenster EN 14351 beschreibt die Erfüllung von nicht weniger als 23 Eigenschaften von Widerstandsfähigkeit gegen Windlast, über Schallschutz bis Einbruchhemmung, jeweils als Einordnung in mehrere Klassen einer Prüfnorm. Die Schlagregendichtheit wird nach der Europäischen Prüfnorm EN 1027 in zehn Klassen eingeteilt. Diese bis zu 23 Prüfergebnisse werden in der CE-Deklaration zusammengefasst. Welche Anforderungen für das einzelne Bauvorhaben maßgeblich sind, richtet sich nicht nach der Norm, sondern nach dem Vertrag und nach nationalen Regeln und dem regionalen Wetter, das von Finnland bis Griechenland verschieden sein kann.
Von den 23 Eigenschaften kann mal eine entfallen, weil sie nicht gebraucht wird, wie zum Beispiel die Nr. 18 »Durchschusshemmung«. Das heißt dann »npd« für »no performance determined«. Die wichtige Brandschutzeigenschaft eines Fensters ist hingegen gar nicht in dieser Norm, sondern in einer eigenen europäischen Norm EN 16034 beschrieben. Auch diese Beschaffenheit wird mit einem CE-Zeichen bestätigt. In der Folge kann ein CE-Zeichen allein nie die Eignung eines Bauprodukts für ein bestimmtes Bauwerk leisten, ohne die Einzelangaben der CE-Deklaration mit den im Einzelfall geltenden Anforderungen abzugleichen. Wie Prof. Zöller in derselben Ausgabe der Zeitschrift beschreibt, findet diese europäische Systematik Eingang in deutsche DIN-Normen, wenn der Wasserandrang an ein Gebäude zukünftig in DIN 4095 in gestuften Klassen definiert wird, und die jeweils geeignete Abdichtung an anderer Stelle in DIN 18533.
Die oft zitierte, 15 cm hoch gezogene Flachdach-Abdichtung gilt für aufgehende Wände. An aufgehenden Bauteilen aus wasserbeständigen und wasserdichten Bauteilen gilt die erforderliche Überlappung der verschiedenen Abdichtungsstoffe, für Flüssigkunststoff auf Stahl zum Beispiel 5 cm, für Bitumenbahn auf wasserundurchlässigem Beton 10 cm und für die Türschwelle gilt ein ganzer Strauß von Maßnahmen, der das Eindringen von Wasser in das Gebäude vermeiden muss. Die Soll-Beschaffenheit des Werks ergibt sich nicht aus den Normen, sondern aus der Art und dem Ort der Anwendung im Gebäude, dem Baurecht, der Planung, den Materialeigenschaften. Diese Materialeigenschaften werden in Normen beschrieben. In diesem speziellen Bereich halten Sachverständige die Normen für maßgeblich.
Um die Dauerbeispiele der juristischen Literatur aufzugreifen, bietet die Industrie Hallen aus Stahlblech an, die nicht unter allen Umständen schlagregendicht sind. Diese Hallen werden rege nachgefragt zum Unterstellen landwirtschaftlicher Fahrzeuge, zum Lagern von Klosettschüsseln und so weiter. Das Gericht hat in dem oft zitierten Urteil entschieden, dass jemand, der in dieser Halle teure Weine verkauft, Anrecht auf ein schlagregendichtes Dach hat. Wenn ein ökobewusster Mensch vertraglich vereinbart, seine Holzfenster mit Bienenhonig beschichten zu lassen, kann er nicht Anspruch auf die üblicherweise zu erwartende technische Lebensdauer von modernen Kunstharzlacken haben. Wer einen Oldtimer erwirbt, wird nicht verlangen, dass ein Antiblockiersystem eingebaut ist. Gerichte haben in zahlreichen Fällen unter Berufung auf die sogenannten allgemein anerkannten Regeln der Technik, die sich in Normen manifestieren sollen, Kunden zu einer nicht bezahlten und nicht bestellten Aufwertung der Bauleistung verholfen.
Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sollen sich vom Stand der Technik durch die praktische Bewährung und die allgemeine Bekanntheit unterscheiden. Praktische Bewährung und allgemeine Bekanntheit sind Faktoren der Zeit. Allerdings sind Baustoffe nicht mehr so definiert und so beschaffen wie vor wenigen Jahrzehnten, seien es Festigkeitsklassen von Beton, Stahlgüten, Sortierklassen von Bauholz, Holzschutz, Glasarten, Abdichtungsbahnen oder Beschichtungsstoffe, von Klebstoffen gar nicht zu reden. An die Stelle der praktischen Bewährung sind Prüfungen im Labor oder im Prüfstand getreten, deren Ergebnisse durch Papiere, CE-Deklarationen, Prüfzeugnisse und Zulassungen dokumentiert werden. Normen beschreiben die Vorgehensweise und die Dokumentation dieser Prüfungen. Die rechtlichen Begriffe sind der technischen Entwicklung nicht gefolgt. Ich würde die zwei sehr interessanten juristischen Artikel gerne lesen, wenn sie der längst eingetretenen technischen Entwicklung Rechnung getragen haben werden.
Sebastian Sage, Dipl.-Ing. Architekt, öffentlich bestellt und vereidigt
als Sachverständiger für Schäden an Gebäuden, Stuttgart und Berlin
Leserzuschrift zu dem Artikel von Mark Seibel: Mangelhafte Bauleistung und technische Regelwerke
In: Der Bausachverständige Heft 4/2023, S. 55 ff. zu Punkt 3. Ausgewählte Beispiele aus der Rechtsprechung, Unterpunkt c), OLG Hamm, Urteil v. 14.08.2019 – 12 U 73/18, S. 64-66
Bei der Diskussion um die Verwendbarkeit bzw. Regelgerechtigkeit der sog. »Kombi-Abdichtung«, also die Verlegung der PMBC-Abdichtung am Übergang vom Beton der WU-Bodenplatte zur aufgehenden Kelleraußenwand, also ein Baustoffwechsel, wird nicht erwähnt, dass es sich bei der aufgehenden Kelleraußenwand um eine Mauerwerkswand handelt. Dies bedeutet, dass die Formstabilität des Untergrunds für die Dickbeschichtung nicht in die Schadensursache an der Abdichtung einbezogen wird.
Das eigentliche Problem dieser Schadensfälle ist die unzureichende Gebrauchstauglichkeit, oft auch die Standsicherheit des Bemessungsnachweises einer erddruckbelasteten, gemauerten Kelleraußenwand gemäß der DIN 1053 bzw. Eurocode 6. Für den Standsicherheitsnachweis wird als Erddruckbelastung nur der sog. »aktive Erddruck« und nicht richtigerweise der um ca. 50% höhere »Erdruhedruck« angesetzt.
Für die besondere Schwachstelle, die Aufstandsfuge der Mauerwerkswand auf der Bodenplatte mit einer horizontalen Abdichtungsbahn (z.B. besandete Bitumenpappenlage), wird kein Nachweis der Schubsicherung geführt. Demzufolge wird bei der Verschiebung der KG-Außenwand nach innen die Abdichtung zerstört. Die zerriebene Mörtelschicht der Aufstandsfuge bildet große Öffnungen auf großen Wandlängen, sodass ein großer Querschnitt für den Wassereindrang von oftmals hunderten Litern Wasser zur Verfügung steht und damit auch das besondere Schadensbild prägt.
Zum OLG-Hamm-Urteil vom 14.8.2019 – Az. 12 U 73/18 wurde von mir ein Artikel veröffentlicht in der Zeitschrift »Der Sachverständige«, »PMBC-Abdichtung am Übergang von der WU-Bodenplatte zum Kellergeschoss-Mauerwerk« 47 (2020) Heft 10, S. 244-257.
Wolf Ackermann, Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Ing. (TH), vereid. Sachverständiger BVS, Freigericht
Leserbrief zum Beitrag von Carsten Nessler: Gefährliches Energiesparen.
In: Der Bausachverständige, Nr. 2/2023, S. 57-59
Nachdem in den sozialen Medien eine gewisse Ankündigung zum Beitrag von Carsten Nessler in Der Bausachverständige erfolgte, war ich gespannt auf den Beitrag. Ich habe mich darauf gefreut, hat mich die Überschrift doch neugierig gemacht. Kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Energiesparen ist richtig, wichtig und bringt uns vorwärts!
Der Beitrag hat mich dann aber sehr enttäuscht und lässt mich an sehr vielen Stellen verschreckt zurück. Es bleiben ein paar Punkte, die ich teilen möchte.
Der Beitrag erschien in der Rubrik »Baurecht«. Das Wortspiel sei gestattet: Mit welchem Recht? Was hat der Beitrag mit »Baurecht« zu tun?
Nach der Lektüre des Beitrags ist die Überschrift für mich ungeeignet. Energiesparen ist nicht gefährlich! Es ist unsere verdammte Pflicht, wir brauchen Lösungen zum Energiesparen! Auf die Ausführung von Potenzialen, Maßnahmen usw. verzichte ich hier.
Schimmelbildung in Wohnbereichen etc. war und ist ein Thema und wird es in Zukunft bleiben. Anhand der beschriebenen Beispiele handelt es sich um Grundlagen der Physik, der Bauphysik. Gerne auch, wie im Beitrag erwähnt, der Thermodynamik.
Dass die Reduktion der Wassertemperatur Potenzial zum Energiesparen birgt, ist unstrittig. Auf Grund der beschriebenen Legionellenbildung ist dies meines Wissens nach (bisher und zum Glück) aber nicht im Fokus. Die Pauschalierung, dass z.B. Räume nicht auskühlen dürfen oder die Heizung nicht heruntergedreht werden sollte, funktioniert nicht.
Vor der Maßnahme nachdenken, informieren, beraten lassen! Klar das Ziel festlegen und kommunizieren. Abschätzen der Konsequenzen einer Maßnahme. Unterstützung holen, sich helfen lassen, dann funktioniert z. B. auch die Reduktion der Raumtemperatur.
Damit ist der Einstieg »Gut gemeintes, aber falsch umgesetztes Energiesparen« erklärt: Richtig handeln und nicht irgendwie und damit ggf. falsch! Energiesparen ist nicht nur gut gemeint, sondern richtig und wichtig! Falsch gesetzte Maßnahmen zur Energieeinsparung, in deren Folge Schäden entstehen, sind keine Rechtfertigung dafür, dass der Wunsch nach Einsparung gefährlich oder nicht richtig ist!
Der Schlusssatz könnte statt »Punkt!« ersetzt werden mit: Energetische Sparmaßnahmen sind ein Teil des Schutzes von Leib und Leben, von Mensch und Natur, heute und in der Zukunft!
Clemens Hecht, Wien, Geschäftsführer von FMI Austria
Anmerkung der Redaktion: Die unrichtige Einordnung des Beitrags von Herrn Nessler in die Rubrik »Baurecht« liegt in der Verantwortung der Redaktion und wird so in Zukunft bei ähnlichen Artikeln nicht mehr geschehen.
Leserbrief: Radonsicheres Bauen
Wann finden die Anforderungen zum radonsicheren Bauen endlich Eingang ins Bauordnungsrecht?
Mittlerweile – seit Ende 2018 – sind das novellierte Strahlenschutzgesetz und die novellierte Strahlenschutzverordnung in Kraft; es gibt im § 123 StrSchG bundesweit gültige Vorgaben für die radondichte Ausführung von Neubauten, sowie im § 154 StrlSchV Aussagen zu zusätzlichen baulichen Maßnahmen für Neubauten in den Radonvorsorgegebieten. Bislang haben die regelgebenden Instanzen – hier vor allem die Bundesbauministerkonferenz und die Landtage der Bundesländer – es nicht geschafft, diese klar formulierten Anforderungen in die Musterbauordnung MBO bzw. in die Bauordnungen der Länder aufzunehmen.
Aber genau dort sollten diese baulichen Anforderungen verankert sein. Welcher Bauplanende oder Bauschaffende schaut von sich aus ins Strahlenschutzgesetz oder die Strahlenschutzverordnung? Daher ist es unbedingt notwendig, die dort per Gesetz erhobenen Anforderungen in die für das Bauen maßgeblichen bauordnungsrechtlichen Regelwerke zu überführen. Außerdem wäre es wünschenswert den Anhang I der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 im Abschnitt 3. Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz um einen Aufzählungspunkt – Schutz vor dem Eintritt gesundheitsgefährdender Gase aus dem Erdreich – z.B. Radon – zu erweitern.
Dipl.-Ing.(FH) Marc Ellinger, Bernau im Schwarzwald, RIZ Radon-Informationszentrum
Leserzuschrift / Anmerkung zum Beitrag: »Wer zahlt bei einer Dachsanierung den Sturmschaden?« von Stefan Lange und Jörg Bach in Der Bausachverständige, Heft 6/2022, S. 30–33
Ich selbst war zehn Jahre lang bei einem großen Sachversicherer als angestellter Sachverständiger tätig. Anschließend habe ich über dreißig Jahre ein eigenes Sachverständigenbüro in Münster als ö.b.u.v. Sachverständiger für die Bewertung von Brand-, Sturm- und Leitungswasserschäden an Gebäuden geführt. Zum 31.12.2021 habe ich meine öffentliche Bestellung zurückgegeben und bin in den Ruhestand eingetreten.
In diesem Berufsleben habe ich immer wieder feststellen müssen, dass bei Architekten, Rechtsanwälten, Richtern und auch Sachverständigenkollegen teilweise erhebliche Unkenntnisse in diesen Schadenangelegenheiten vorkommen. Deshalb hier meine Anmerkungen:
Grundlage des Eintritts und der Anerkennung eines versicherten Sturmschadens – falls in der Sachversicherung (Gebäude-, Wohngebäude- und Hausratversicherung) ist die Erfüllung der jeweiligen Versicherungsvertragsbedingungen. So ist in der Regel das Sturmereignis mit: »Ein Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach der Beaufortskala (Windgeschwindigkeit mindestens 62 km pro Stunde)« definiert.
Weiterhin sind in den Versicherungsbedingungen folgende Sicherheitsvorschriften vereinbart: »Versicherte Sachen sind stets in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten. Dies gilt insbesondere für wasserführende Anlagen und Einrichtungen, Dächer und außen angebrachte Sachen.«
Auch der folgende Punkt ist Vertragsbestandteil: »Am Gebäude werden Baumaßnahmen durchgeführt, in deren Verlauf das Dach ganz oder teilweise entfernt wird.« Es handelt sich um den Vertragsbestandteil »Anzeigepflichtige Gefahrenerhöhung«.
Es ist also gar nicht so einfach, den Sachversicherer zur Übernahme dieser Schadenkosten heranzuziehen. Das Dach des Hauses, welches im Rahmen der Sanierung ganz oder in Teilen abgedeckt wurde, entspricht nicht mehr den Anforderungen an einen ordnungsgemäßen Zustand, auch nicht, wenn dieses Dach mit einer Folie provisorisch oder notgesichert wurde.
Sofern dem Versicherer vor Beginn der Sanierungsarbeiten eine umfassende Mitteilung hierzu gemacht wurde und von diesem keine weitere Reaktion erfolgte, dürfte der volle Versicherungsschutz gegeben sein. In der Regel schließt jeder Sachversicherer aber für den Zeitraum der Dachsanierung den Versicherungsschutz zum Sturmschadenrisiko aus.
Sofern aber doch Versicherungsschutz weiterbesteht, muss die Windstärke von mindestens 8 auf der Beaufortskala nachgewiesen werden, das ist gerade bei »Sturmböen« nicht immer einfach, da diese von den Wetterstationen nicht generell erfasst werden.
Weiterhin ist das einfache Eindringen von Regenwasser auch bei Vorlage der Windgeschwindigkeit nicht generell versichert. Der Sturm muss durch unmittelbare Einwirkung auf die versicherte Sache (das Gebäude) eine Öffnung geschaffen haben, durch die das Regenwasser in der Folge in das Gebäude eindringen und zum Schaden führen konnte. Eindringendes Regenwasser (auch Starkregen), das zum Durchnässungsschaden führt, weil die Folieneindeckung (Notdach) z.B. unzureichend überdeckt wurde, Anschlüsse zu aufgehenden Bauteilen oder Durchdringungen nicht ausreichend eingedichtet wurden oder sich wassergefüllte Folienblasen bilden, die dann platzen, bedingen keinen Versicherungsschutz in der Sachversicherung.
Hier greift dann in der Regel die Betriebshaftpflichtversicherung des ausführenden Unternehmens. Sofern die Baumaßnahme aber von einem bauleitenden Architekten / Bauingenieur begleitet wird, wird auch dieser zu den Schadenkosten herangezogen, weil auch ihm eine Mitschuld, wegen mangelnder Bauaufsicht, zugewiesen werden kann. Das ist den meisten Bauherren und den Architekten nicht bekannt.
In dem Beitrag wird dann auf die Problematik des Zeitwerts hingewiesen. Aber hier greift der Artikel nicht weit genug. Was ist denn der Zeitwert? Im Laufe meines Berufslebens habe ich sehr viele Sach- und Haftpflichtschäden bearbeitet. Die Definition der Sachversicherer und der Haftpflichtversicherer unterscheidet sich hierzu grundsätzlich. Es ist verkürzt Folgendes zu berücksichtigen:
Der wirtschaftliche Zeitwertschaden, als Ausgleich der Vermögensminderung, ist nicht zu verwechseln mit dem technischen Zeitwertschaden, da diese aus völlig unterschiedlichen Gesichtspunkten gesehen werden müssen. Soweit sich der wirtschaftliche Schaden, als Verkehrswert- / Marktwertminderung der Sache, unter Berücksichtigung des § 249 ff BGB, als Ausgleich der schadenbedingten Vermögensminderung ableitet, ergibt sich der technische Schaden allein aus der Beurteilung des Bauwerks und seiner einzelnen Bauteile und der darauf zurückfallenden technischen Lebenserwartung bis zum Untergang derselbigen, ohne Einfluss von Verkehrswert- / Marktwertdaten. Sofern ein Gebäude oder ein Gebäudeteil aufgrund des altersbedingten und allgemeinen Zustands für den ihm zugedachten Nutzungsrahmen nicht mehr verwendbar ist, tritt eine wirtschaftliche Vollentwertung ein. Aus technischer Sicht ist dieses Gebäude oder das Gebäudeteil aber, solange es bestimmten Grundbedingungen entspricht, die an ein Gebäude oder seine Teile gestellt werden, noch mit einem technischen Restwert behaftet. Allein die Anwendung der Altersabminderung unterscheidet sich erheblich. So ist bei der Ermittlung des wirtschaftlichen Zeitwerts eine lineare Abwertung, entsprechend den Vorgaben durch die ImmoWert-V, der Sachwertrichtlinie und der einschlägigen Rechtsprechung vorzunehmen. Bei der Ermittlung des technischen Restwerts ist eine parabelkurvenähnliche, degressive Entwertung, in Anlehnung an die Tabelle nach Ross, vorzunehmen, wie dieses in der Sachversicherung allgemein üblich ist. Aus diesen beiden völlig unterschiedlichen Betrachtungsebenen heraus ermittelte Zeitwerte differieren häufig in nicht unerheblichem Umfang.
Die wirtschaftliche Lebensdauer ist in erheblichem Maße von marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und zudem auch von Einwirkungen des »Zeitgeistes« abhängig.
Im Gegensatz zur Sachversicherung ist die richtige Ermittlung und Ausweisung des »Zeitwertschadens« im Bereich der Haftpflichtversicherung nicht relativ einfach aus einschlägigen Tabellenwerten, wie z.B. von Ross / Brachmann, abzuleiten, sondern bedarf in jedem Einzelfall einer kritischen Beurteilung der betroffenen Sache, des zu ermittelnden Verkehrs- / Marktwerts, der marktbeeinflussenden Randbedingungen und der individuellen Situation. Grundlage des Ersatzanspruchs eines Geschädigten oder des Regressanspruchs eines Sachversicherers ist immer der Verkehrs- / Marktwert der vom Schaden betroffenen Sache, nicht der vom Sachversicherer hinzugezogene »technische Zeitwert«.
Beispiel:
Der technische Zeitwertwert einer Ladeneinrichtung sinkt stetig mit dem Alter unter Berücksichtigung der Abnutzung durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch, bis zum endgültigen Verfall und Untergang.
Der »wirtschaftliche Zeitwert« ist bei einer Ladeneinrichtung nicht nur vom Alter und der Abnutzung abhängig. Hier spielen in erster Linie der Zeitgeist und die Lage des umgebenden Ladenlokals, wie auch die Branche eine gravierende Rolle. Ladeneinrichtungen in 1a-Toplagen unterliegen einer relativ kurzen wirtschaftlichen Lebensdauer, da diese Läden dem verkaufsfördernden Geschmack des Zeitgeistes im Besonderen nachkommen müssen.
In weniger attraktiven Geschäftslagen und Branchen, in denen die Zeitgeisteinflüsse weniger berücksichtigt werden, verläuft die wirtschaftliche Entwertung mit deutlich verzögertem Verlauf.
Läden in ländlichen und dörflichen Lagen weisen die längste wirtschaftliche Nutzungsdauer auf, da hier in der Regel nachweislich die Einflüsse des Zeitgeistes wenig berücksichtigt werden und die Nutzungsdauer ggfls. mit der Lebensdauer konform geht.
Diese unterschiedlichen Definitionen des Oberbegriffs »Zeitwert / Zeitwertschaden« führen auch in der Regressbearbeitung zwischen Sach- und Haftpflichtversicherer oder in streitgegenständlichen Auseinandersetzungen leider sehr häufig zu Fehlentscheidungen aufgrund falscher Bewertungsansätze in den zugrunde gelegten Sachverständigengutachten.
Zeitwert ist nicht gleich Zeitwert!
Dipl.-Ing. Architekt Heinz Scheiper, Münster
(Leserbrief in Der Bausachverständige Heft 2/2023)
Antwort auf den Leserbrief von Heinz Scheiper (Der BauSV, Heft 2/23) zum Artikel von Stefan Lange und Jörg Bach in Der Bausachverständige, Heft 6/2022, S. 30-33
Bezüglich der Leserbriefaussage, dass eine versicherte Gefahr zuvor vorliegen und nachgewiesen werden muss, stimme ich dem Kollegen zu.
Mit meiner Aussage, dass eine Sturmbö (Begriff: Sturmbö = eine heftige Windbewegung von > 62 km/h sprich > 8 bft) die vorhandene Unterspannbahn abgedeckt hat, liegt eine sturmbedingte direkte Einwirkung vor, welche ebenfalls durch den Deutschen Wetterdienst im Nachgang bestätigt wurde.
Zusätzlich wirkt im Sinne der VGB 2010 (A) die Beweiserleichterung für den Versicherungsnehmer.
Weiterführend trägt der Kollege vor, dass die versicherte Sache in einem ordnungsgemäßen Zustand gehalten werden soll bzw. im Zuge einer Sanierung und/oder Instandsetzung dem Versicherer mitgeteilt werden sollte / muss, dass eine Gefahrenerhöhung vorliegt.
Bezüglich der Gefahrenerhöhung beginnen auch die ersten unterschiedlichen Auffassungen der Fachleute, denn nach dem Versicherungsvertragsgesetz § 23 ist der Versicherungsnehmer nach Vertragsabschluss weder dazu verpflichtet, eine Gefahrenerhöhung herbeizuführen bzw. dies dem Versicherer nach Kenntniserhalt sofort mitzuteilen.
Nach § 27 des VVGs heißt es jedoch, dass es sich um eine unerhebliche Gefahrenerhöhung handelt, wenn bereits bei Vertragsabschluss dem Versicherer die vorliegende Gefahr bekannt war bzw. bekannt sein muss, so ist diese als mitversichert zu betrachten.
(Bei einem alten Gebäude könnte man also davon ausgehen, dass eine Sanierung oder Modernisierung im versicherten Zeitraum anfallen könnte.)
In unserem Falle wurde der Versicherer aber über die Gefahrenerhöhung informiert und der Beitrag sollte auch den Leser dazu sensibilisieren, dieses stetig vorzunehmen, um derartig lästige Diskussionen zu vermeiden.
Bezüglich der Aussage der Unterspannbahnen, teile ich die Auffassung meines Kollegen nicht in Gänze, denn nach dem Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen des Deutschen Dachdeckerhandwerks und dort unter Punkt 3.2 (4) sind Behelfsdeckungen aus Unterspannungen so auszuführen, dass sie die Funktion erfüllen, für einen begrenzten Zeitraum den regensichernden Schutz des Gebäudes oder der darunterliegenden Bauteilschichten übernehmen zu können.
Somit liegt für mich eine funktionstüchtige Konstruktionsebene für den Zeitraum der Sanierungsmaßnahme vor. (Sicherlich ist hier zu prüfen, inwieweit durch den ausführenden Unternehmer das richtige Unterspannbahnprodukt für den zu erwartenden Zeitraum der freien Bewitterung gewählt wurde.)
In unserem Falle konnte dieses jedoch auf Grund des engen Zeitraumes vernachlässigt werden.
Zu der Aussage, dass eindringender Schlagregen ins Gebäudeinnere keinen Deckungsschutz genießt, stimme ich dem Kollegen zu. In unserem Falle wurde jedoch die Behelfsdeckung erfasst und abgedeckt, somit liegt eine direkte Einwirkung durch Sturm vor und stellt daher auch in unserem Falle einen versicherten Schaden dar.
Die greifende Haftung der Betriebshaftpflicht von Handwerker bzw. falls vorhanden, auch Planer teile ich wiederum uneingeschränkt mit meinem Kollegen. Dieses wurde ja durch meinen Beitrag auch nicht in Abrede gestellt.
Was die Aussage der Zeitwertermittlung betrifft, gibt es selbstverständlich Unterschiede in den Regulierungsgrundlagen zwischen dem Gebäudeversicherer, der in unserem Falle zum gleitenden Neuwert versichert war, und dem Haftpflichtversicherer, der im Allgemeinen nur zum Zeitwert reguliert, wenn wertsteigernde Ersatzvornahmen von alten Bauteilen und Konstruktionen vorgenommen werden bzw. die Kosten der Instandsetzung den Wert der beschädigten Sache vor Schadenseintritt übersteigen würden.
Um jedoch hier allen vorkommenden Eventualitäten gerecht werden zu wollen, wie durch den Kollegen benannt, müssten wir nicht nur auf die unterschiedliche Zeitwertermittlung zwischen Sach- und Haftpflichtversicherer eingehen, sondern auch auf die unterschiedlichen Versicherungswerte des Sachversicherers selbst (gemeiner Wert, Zeitwert, Neuwert, gleitender Neuwert).
Stefan Lange, ILS Bauconsulting, Iserlohn
(Leserbrief in Der Bausachverständige Heft 3/2023)
Leserzuschrift zum Beitrag von Ingo Kern »Garagenverordnung im Bild. Zurück in die Steinzeit« in Der Bausachverständige, Heft 1/2021
Der Beitrag zeigt auf, dass die Garagenverordnungen, wie viele gesetzliche Vorgaben, nur einen Mindeststandard bieten und in vielen Fällen funktionalen Anforderungen zumindest zum Teil nicht (mehr) gerecht werden. Zum Teil schafft es der Beitrag auch, wichtige Aspekte eines gut funktionieren Parkgebäudes darzustellen. Dafür vielen Dank.
Schön wäre es gewesen, wenn die gesetzlichen Vorgaben, privaten Regelwerke und die vielen aufgeführten Themen aus Gerichtsentscheidungen einmal übersichtlich unter den Aspekten der Gebrauchstauglichkeit, einer subjektiven Bestellererwartung und den a.a.R.d.T. bewertet worden wären. Damit hätte der Beitrag wertvolle Basis für die zukünftige Bewertung von Mängeln, für die Beratung bei Kaufentscheidungen, aber auch bei der Grundlagenermittlung für Planungen sein können.
Das gelingt dem Beitrag leider nicht, da er sich weitgehend in einer Häufung von unsachlich übertrieben wertenden Adjektiven verliert. Die Garagenverordnungen sind beileibe kein »Witz«. Sie sind ein Mindeststandard, den Planer, Erwerber, Nutzer und Sachverständige und Bauherren als einen solchen zu bewerten haben. Selbstverständlich planen wir in unserem Büro seit Jahrzehnten keine Stellplätze mit 2,30 m Breite, sie werden aber auch von keinem unserer Auftraggeber so gewollt. Sie stellen meiner Ansicht nach weder eine Üblichkeit noch die a.a.R.d.T. dar.
Auf der anderen Seite ist es nicht politisches Ziel, dass Stellplätze immer größer und komfortabler werden, daher ist es auch nicht Aufgabe der GaV, Derartiges festzulegen. Im geförderten Wohnungsbau wäre das dem Ziel, »bezahlbaren Wohnraum« zu schaffen, nicht zuträglich. Im gehobenen Standard sieht das selbstverständlich anders aus. Da sind Stellplätze mit größeren Abmessungen ggf. zu erwarten. Bei einer »normalen« Eigentumswohnung werden zumindest in Nordbayern die Stellplätze in einer TG nahezu zu den Herstellkosten verkauft, da sich die Erwerber mehr als 25.000–30.000 Euro dafür nicht leisten können.
Andreas Grabow, GRABOW + HOFMANN Architektenpartnerschaft BDA,
Nürnberg, Juni 2021
Antwort von Ingo Kern auf die Leserzuschrift von Andreas Grabow zum Artikel »Garagenverordnung im Bild«
Das ist einer dieser Momente, da man einfach froh ist, wenn Kritik den Zweck bestätigt, wie man sagt, Schönheit ist nur sichtbar durch das Gegenteil. Die Debatte ist endlich da. Und wie es sich für einen Anfang gehört, soll sie nicht zeigen, was menschenmöglich, sondern was Menschen möglich ist. Mancher findet im Beitrag Anstöße für weiterführende Gedanken und wagt sich an ein neues Thema. Andere verzagen im Ansturm neuer Gedanken. Von allen Möglichkeiten eine allerdings doch eher naheliegend erscheinende, wenn man nicht gerade Dienst bei der Feuerwehr hat, ist allemal: Erst mal in Ruhe nachdenken.
Es ist äußerst schwierig, eine »Alles-in-allem-Anleitung« zu schaffen, durch deren Anwendung alles so ordentlich, beschaulich und unproblematisch werden könnte, etwa nach Maßgaben von Tabellen, Urteilen, Gewohnheiten oder Berechnungsprogrammen. Rechtsanwältin Carola Dörfler-Collin schrieb im Bausachverständigen 6/2007: »Die […] notwendige Individualität erfordert es, dass sich das Bauwerk nicht nur als Ergebnis […] routinemäßigen Schaffens darstellt, sondern, dass es […] über die Anwendung der einschlägigen Lösungsmittel hinausgeht.« Praxistauglich und zukunftsfähig muss es sein. Im neuen Beitrag »EAR 05 im Bild« wird daher ein Schlaglicht auf privatrechtliche Perspektiven geworfen. Er könnte einige dunkle Flecken aufhellen. Ein Rezeptbuch ist das aber auch nicht.
Wenn »unsachlich und übertrieben« bedeutet, dass der Text einen zupackend-direkten Stil hat, der vor zynischen Zuspitzungen – die ich todernst meine – nicht zurückschreckt, dann gebe ich Ihnen recht. Sie sagen, die Garagenverordnung sei kein »Witz«, sondern der Mindeststandard. Nun, an vorderster Stelle ist sie erst einmal eine rückwärtsgerichtete Entwicklung. Pinguine haben das auch erlebt. Pinguine – habe ich gelesen – sind faszinierende Beispiele für die regressive Evolution, bei der sich bestimmte Merkmale wieder zurückbilden. Viele von uns assoziieren Evolution eher mit Akkumulation: Dinge werden mehr und besser. Genauso gut können sich Fähigkeiten aber auch zurückbilden oder verloren gehen. Die Vorfahren der Pinguine konnten fliegen. Mit dem Verlust ihrer Flugfähigkeit konnten sie sich besser an ihren Lebensraum anpassen, weil sie größer und schwerer werden konnten. Auch die reduktive Evolution bringt eigentlich Vorteile – sollte man meinen –, vielleicht habe ich da etwas übersehen?
Eine Umsatz- und Gewinnabsicht schließt ein »Dienen« zugunsten einer Tendenz nicht von vornherein aus. Wir sollten nicht vergessen, dass Bauträger und Projektentwickler in der Hauptsache Geschäfte tätigen, die in der gewinnorientierten Gesellschaft der Vermehrung ihres Vermögens dienen. Diese Eigenart verlangt aber auch, dass Zukunftsentwicklungen erkannt und zeitgemäße Entscheidungen getroffen werden. Deswegen sollte man den objektiven Empfängerhorizont des Verbrauchers nie aus dem Auge verlieren. Bedenkt man, dass der Hase nicht bequem, sondern im Pfeffer liegt, dann kann es sein, dass sich das widerborstige Problem nur mit einem Verweis auf die Zahlungsfähigkeit der Bürger nicht so einfach beseitigen lässt. An Beispielen für die Problematik des Zögerns fehlt es nicht. Der Vorwurf der Inkonsequenz gerade in Hinblick auf Forderungen nach Fortschritt, ist beständig an der Tagesordnung. Er besteht genau darin, dass sich der Fortschrittsgedanke nicht in die Garagenverordnung einfügt.
Dipl.-Ing. Ingo Kern,
Heilbronn, Juni 2021
Weitere Leserzuschrift zum Beitrag von Ingo Kern »Garagenverordnung im Bild«
Ein Kompliment für den hervorragenden (längst überfälligen) Fachbeitrag. Mit den von Ingo Kern geschilderten Mängeln habe ich tagtäglich zu tun. Ich komme von der Insel Rügen. Hier ist aufgrund der zahlreichen Ferien- und Eigentumsimmobilien eine sehr hohe Anzahl von Tiefgaragen gegeben. Herr Kern hat alle Probleme umfänglich angesprochen. Bei den Stellplätzen gehe ich sogar noch einen Schritt weiter. In der EAR 05 und dem BVS-Standpunkt »Stellplatzbreiten« wird sich lediglich mit den Stellplatzbreiten auseinandergesetzt. Stellplatzlängen werden nicht thematisiert. Wie Sie richtig schreiben, gibt es allein fünfzig PKW-Typen unterschiedlicher Hersteller mit Längen von 4,95 m bis 5,15 Meter. Ich habe in kurzer Zeit mindestens 20 PKW der gehobenen Mittelklasse von sogar 5,15 bis 5,40 m recherchiert. Abhängig von der üblich zu erwartenden Beschaffenheit sollten daher auch bei den zur Fahrbahn rechtwinklig angeordneten Stellplätzen Stellplatzlängen von mindestens 6 m (wie vom Autor für die parallelen Stellplätze und hintereinander angeordneten Stellplätze ausgewiesen) hergestellt werden. Nicht berücksichtigt werden bei der ganzen Thematik die immer mehr werdenden Ladestationen für E-Autos, Anhängerkupplungen sowie die in Ferienregionen zu erwartenden Fahrradträger.
Neben den Stellplatzbreiten und -längen sind die Kurvenradien immer wieder ein ganz spezielles Thema. Der größte Fehler, den ich Immer wieder bei Planern feststelle, ist, dass der 0-Punkt für den 5-m-Radius plan- und wahllos festgelegt wird.
Wie es im Artikel richtig angemerkt wird, werden die Planer mit den beschriebenen Mängeln konfrontiert, sind die Fragezeichen über den Köpfen der Stararchitekten und Künstler deutlich sichtbar. Vielleicht sollte man zur Abnahme die Bedingung aufstellen, dass diese Leute bei voll besetzter Tiefgarage mit ihrem meist oberklassigen PKW einparken sollen.
Dipl.-Ing. Matthias Ruhnke, Sachverständigenbüro für Hochbau,
Bergen auf Rügen, Juni 2021
Leserzuschrift zum Beitrag von Andreas Koenen »Verfassungsrechtliche Grenzen des richterlichen Umgangs mit Sachverständigen« in Der Bausachverständige, Heft 2/2021
Die verfassungstheoretische Ausführung über das Verhältnis zwischen dem rechtmäßigen Richter und dem Sachverständigen belehrt und erbaut den Leser. Was dabei außer Acht bleibt, ist dass das verfassungsgemäße Recht auf rechtliches Gehör und auf den gesetzmäßigen Richter heute von einer ganz anderen Seite bedroht ist. Die Gerichte sind überlastet, ersticken unter einer Prozesslawine. Der ordentliche Gang der Rechtsprechung verfällt unter dem Druck der Zeit. Recht kriegen ist für Leute mit Zeit und Geld. Wer unter Zeitdruck steht, kann auf den Rechtsweg nicht vertrauen. Die Gerichte haben kein Hilfspersonal, Richter laufen selbst zum Kopierer, ein Gerichtsdiener ist eine Geschichte aus einer anderen Zeit oder einem anderen Land. Um nur ein Detail zu nennen, das jeden verblüffen muss, der mal ein französisches oder englisches Gericht hat kennenlernen dürfen.
Um der Not abzuhelfen, sprießen außergerichtliche Konfliktlösungen wie Pilze aus dem Boden. Schiedsgerichte, Schiedsgutachten, Mediation, Adjudikation, Friedensrichter, Mullahs und so weiter übernehmen die Lösung von Konflikten, die früher entweder friedlich zwischen den Parteien oder streitig vor Gericht ausgetragen wurden. Wenn die Richter in unseren westlichen Nachbarländern so viel souveräner auftreten, hängt das nicht zuletzt damit zusammen, dass sie die Mitwirkung dieser Nebengerichtsbarkeiten viel öfter als hierzulande akzeptieren oder sogar empfehlen. Bei diesen alternativen Streitlösungsverfahren helfen Sachverständige mit ihren Sachkenntnissen, mit ihrer Konflikterfahrung, mit ihrer Zusatzausbildung in Konfliktlösungstechniken, mit ihrem Vertrauen begründenden Auftreten, das jungen Richtern manchmal mangels Erfahrung so ganz abgeht. Gerade selbstständige Beweisverfahren – also Sachverständigenverfahren - werden gerne dem jüngsten und am wenigsten erfahrenen Richter der Kammer übertragen.
Vor diesem Hintergrund hat sich die im Gesetz so genannte Anleitung des Sachverständigen durch den Richter zu einer oft vertrauensvollen Zusammenarbeit im gegenseitigen Respekt weiterentwickelt. Nun erleben wir, dass konservative Juristen diese Entwicklung kritisieren, sie sei sogar nicht verfassungsgemäß. Da muss die Diskussion begonnen werden, ob es besser ist, dass ordentliche Rechtsprechung unter einer Lawine der Überarbeitung zusammenbricht oder ob die Arbeitsteilung zwischen Richtern und Sachverständigen im Sinne der bereits erfolgreich bestehenden Praxis weiterentwickelt wird. Ich sehe zurzeit keine Bereitschaft der Gesetzgeber, die Gerichte so auszustatten, dass sie dieser Unterstützung nicht bedürfen würden. Also muss wohl oder übel über den anderen Pfad gesprochen werden.
Dipl.-Ing. Sebastian Sage
Öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger
für Schäden an Gebäuden von der IHK Region Stuttgart,
Juni 2021
Leserzuschrift zum Beitrag von Georg Göker »Anschlüsse richtig planen und sanieren: Abdichtung bodentiefer Fenster« in Der Bausachverständige, Heft 1/2021
Es ist immer wieder erstaunlich, welche praxisuntauglichen, unmöglichen Konstruktionen veröffentlicht werden, z.B. Abb. 3 höhengleicher Türanschluss auf Seite 23:
Wie soll »Stahlbeton« über eine Fuge von ca. 1 cm zwischen Rinnenkörper und Stahlkonstruktion eingebracht werden?
Wo läuft Spritzwasser von der Tür hin, sicherlich nicht ausschließlich in die Rinne, sondern unter der Tür ins Rauminnere und anderswo?!
Deshalb: »Untere Türanschläge und -schwellen sind nicht zulässig«.
Wer sowas macht, braucht sich nicht wundern, wenn seine Haftpflichtversicherung streikt oder ihm kündigt.
Claus Becker, Freier Architekt und Bausachverständiger,
Heidelberg, April 2021
Antwort auf die Leserzuschrift von Claus Becker zum Artikel von Georg Göker in Heft 1/2021
Bei der Abbildung 3 handelt es sich um eine Prinzipskizze und nicht um ein Planungsdetail. Aus diesem Grund hat die zeichnerische Darstellung keine Maßangaben. Im Vordergrund steht die Darstellung der Los- und Festflanschkonstruktion.
»Nur vereinzelt werden in der Praxis Lösungsansätze gezeigt, wie schwellenfreie Abdichtungskonstruktionen ausgeführt werden können, z.B. in den BWA-Richtlinien für Bauwerksabdichtung, Band 3, Abb. 16 (vgl. [10]; Bild 3). Die dort gezeigte Lösung Festflanschkonstruktion bleibt aber in der Praxis meist unberücksichtigt, weil diese zu teuer und zu planungsintensiv ist.« (s. S. 24)
Herr Becker hat insofern recht, dass zusätzliche begleitende Maßnahmen erforderlich sind, um die Funktionsfähigkeit von höhengleichen bzw. barrierefreien Türanschlüssen zu gewährleisten. Die begleitenden Maßnahmen werden in meinem Beitrag im Abschnitt 7 beschrieben. Die Meinung von Herrn Becker unterstreicht die Komplexität dieser Anschlüsse in der Praxis und untermauert die Zusammenfassung in meinem Beitrag: »Abdichtungsanschlüsse an schwellenlose, barrierefreie Tür- und Fensterkonstruktionen können nur dauerhaft funktionssicher ausgeführt werden, wenn die spezifischen, Gewerke übergreifenden Anforderungen an die Tür- und Fensterelemente sowie an die Abdichtung bereits bei der Detailplanung durch einen Fachplaner berücksichtigt werden. Gleichzeitig müssen die Gewerke und die Montagefolgen koordiniert werden.« (s. S. 28)
Insofern gebe ich Herrn Becker recht, dass Abdichtungsanschlüsse an schwellenlose, barrierefreie Tür- und Fensterkonstruktionen, wie sie in der Mehrzahl bis heute ausgeführt werden, große Haftungsrisiken für die Planer und für die Ausführenden mit sich bringen. Das wollen wir im Arbeitskreis mit dem verbändeübergreifenden Merkblatt »Schnittstelle Bauwerksabdichtung – Baukörperanschluss bodentiefer Elemente« und der »Planungshilfe – Barrierefreie Übergänge bei Dachterrassen und Balkonen« des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerkes e.V. ändern.
Die BWA-Richtlinien für Bauwerksabdichtung, Band 3, aus der die hier zitierte Abb. 3 stammt, wurde im Jahr 2009 veröffentlicht und befindet sich derzeit in der Überarbeitung. Bei der Überarbeitung wird der aktuelle Stand aus dem erwähnten Merkblatt einfließen.
Georg Göker, (Dipl.-Ing (FH)., Dipl.-Wirtsch.-Ing.(FH),
von der Industrie- und Handelskammer Schwaben
öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger
für Flachdach- und Bauwerksabdichtung,
Kempten (Allgäu), April 2021