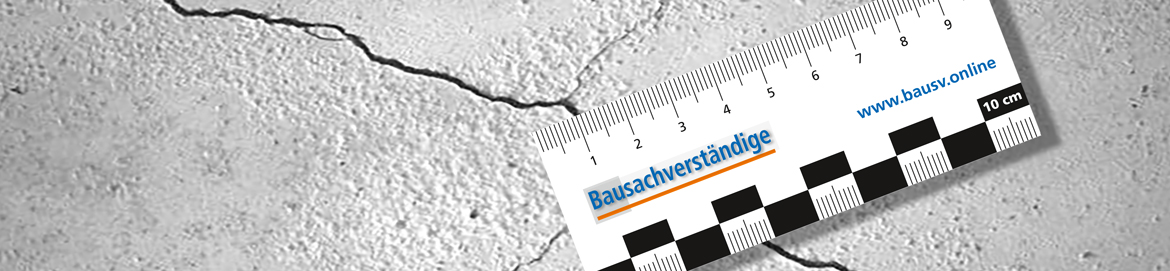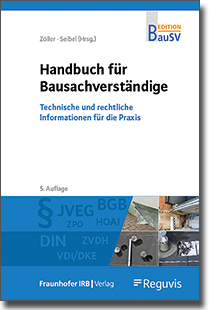Leitsätze
- Die Aufwendungen eines Beteiligten für die Teilnahme eines privaten Sachverständigen an einem Termin zur Beweisaufnahme (Einnahme eines Augenscheins) sind in der Regel nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig.
- Die Aufwendungen eines Beteiligten für die Teilnahme eines privaten Sachverständigen an einer mündlichen Verhandlung sind – ausnahmsweise – dann als notwendig anzuerkennen, wenn sich der Beteiligte aufgrund der damaligen Prozesslage zur Zuziehung des Sachverständigen herausgefordert sehen durfte. Dies kann der Fall sein, wenn bei der Beurteilung der Zumutbarkeit von Lärmimmissionen für die Nachbarschaft möglicherweise entscheidungserhebliche fachliche Fragen zur Schallausbreitung und Schalldämmung streitig sind.
Aus den Gründen
Die Parteien stritten um eine Baugenehmigung zur Umnutzung und Sanierung eines Gebäudes, die auch die Herstellung von 26 Stellplätzen (einschließlich drei Carports) auf dem Baugrundstück im Innenhof umfasste. Streitig war insbesondere, ob dies gegenüber dem vorherigen Zustand zu einer deutlich erhöhten Lärm- und Abgasentwicklung führe. Eine dem Gericht vorgelegte Immissionsprognose eines Ingenieurbüros kam zu dem Ergebnis, dass bei allen Varianten der Anordnung der Stellplätze die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete für den Tageszeitbereich von 55 dB(A) bzw. 85 dB(A) für kurzzeitige Geräuschspitzen unterschritten würden. Im Nachtzeitbereich werde der Immissionsrichtwert von 40 dB(A) überschritten, bei den Varianten mit Carports hingegen unterschritten.
[…]
Wie das Verwaltungsgericht zutreffend ausgeführt hat, sind Aufwendungen für private, d.h. nicht vom Gericht bestellte Sachverständige gemäß § 162 Abs. 1 VwGO nur dann erstattungsfähig, wenn diese Aufwendungen zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren. Ob dies der Fall ist, beurteilt sich nicht nach der subjektiven Auffassung der Beteiligten, sondern danach, wie eine verständige Partei, die bemüht ist, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, in gleicher Lage ihre Interessen wahrgenommen hätte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in dem gemäß § 86 VwGO von der Untersuchungsmaxime beherrschten verwaltungsgerichtlichen Verfahren von Amts wegen der Sachverhalt zu erforschen und der Umfang der Beweisaufnahme zu bestimmen ist.
In diesem Verfahren sind daher zwangsläufig der Erstattungsfähigkeit der Kosten für private Sachverständige engere Grenzen gesetzt als in dem von der Verhandlungsmaxime beherrschten Zivilprozess, sodass die dort entwickelten Grundsätze nicht ohne Weiteres zu übernehmen sind. Die Einholung eines Privatgutachtens durch eine Partei ist hiernach nur – ausnahmsweise – dann als notwendig anzuerkennen, wenn die Partei mangels genügender eigener Sachkunde ihr Begehren tragende Behauptungen nur mithilfe des eingeholten Gutachtens darlegen oder unter Beweis stellen kann.
Außerdem ist der jeweilige Verfahrensstand zu berücksichtigen: Die Prozesssituation muss das Gutachten herausfordern, und dessen Inhalt muss auf die Verfahrensförderung zugeschnitten sein (zum Ganzen: BVerwG, Beschluss vom 11. April 2001 – 9 KSt 2/01 Rn. 3, m.w.N.). Da stets auf den Zeitpunkt der die Aufwendungen verursachenden Handlung abgestellt werden muss, ist einerseits ohne Belang, wenn sich diese Handlung im Nachhinein als unnötig herausstellt, andererseits sind die Aufwendungen für ein Privatgutachten, das ohne das Bestehen einer »prozessualen Notlage« eingeholt und in den Prozess eingeführt wurde, auch dann nicht erstattungsfähig, wenn der Prozessgegner und das Gericht auf das Gutachten eingehen, es sich also nachträglich als nützlich erweist oder gar weitere Beweiserhebungen erübrigt.
War das Erscheinen der Sachverständigen zur mündlichen Verhandlung nicht durch eine entsprechende Aufforderung des Gerichts veranlasst worden, sind die entstandenen Kosten nur nach Maßgabe der Voraussetzungen erstattungsfähig, unter denen Aufwendungen für private, also nicht vom Gericht bestellte Sachverständige erstattet werden können. Allerdings ist es auch einem beigeladenen Vorhabenträger nicht von vornherein und aus grundsätzlichen Erwägungen verwehrt, im Rechtsstreit um die Rechtmäßigkeit einer Planungsentscheidung zu ihrer Verteidigung private Sachverständigengutachten vorzulegen und die hierfür entstandenen Kosten in das Kostenfestsetzungsverfahren einzubringen. Entsprechendes gilt, wenn es um die Rechtmäßigkeit einer Baugenehmigung geht. Fordert die Prozesssituation die Teilnahme des Sachverständigen an der mündlichen Verhandlung heraus, können die dafür entstehenden Kosten selbst dann erstattungsfähig sein, wenn die Kosten desselben Sachverständigen für das zuvor von diesem schriftlich erstellte Gutachten als nicht erstattungsfähig angesehen werden.
Gemessen an diesen Maßstäben hat das Verwaltungsgericht die Aufwendungen der Beigeladenen für die Teilnahme des Sachverständigen P. im Termin zur Beweisaufnahme am 13. Oktober 2022 zu Recht als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung nicht notwendig angesehen. Bei einem Termin zur Einnahme eines Augenscheins geht es dem Gericht in der Regel nur darum, sich einen allgemeinen Überblick über die Sache, insbesondere auch die Örtlichkeit zu verschaffen und sich die mit dem Vorhaben verbundenen Probleme aus der Sicht der Beteiligten erläutern zu lassen; zu dieser allgemeinen Einführung in den Streitstoff und zu der notwendigen Veranschaulichung ist die Beiziehung des privaten Sachverständigen in der Regel nicht erforderlich. Eine andere Beurteilung ist auch im vorliegenden Fall nicht geboten. Der Beweisbeschluss vom 19. September 2022, mit dem auch die Ladung zum Ortstermin erfolgte, enthielt keinen Hinweis darauf, dass der Termin auch der Erörterung der Sach- und Rechtslage dienen sollte.
Der Umstand, dass die Berichterstatterin dem Sachverständigen Gelegenheit gab, sich zu bestimmten Aspekten der Lärmentwicklung und Schalldämmung zu äußern, und das Verwaltungsgericht in seinem Urteil vom 2. Dezember 2022 auch auf Äußerungen des Sachverständigen im Ortstermin Bezug genommen hat, genügt nach den oben dargelegten Grundsätzen (Ex-ante-Sicht) nicht, um die Notwendigkeit seiner Teilnahme an dem Termin zu rechtfertigen. Es war erkennbar, dass die Sach- und Rechtslage, insbesondere auch Fragen zu der Lärmausbreitung und Schalldämmung, in der mündlichen Verhandlung vor der gesamten Kammer umfassend und abschließend erörtert werden sollte und die Sachverständigen dort noch Gelegenheit haben würden, sich zu diesen Fragen fachlich zu äußern.
Anders liegt es hingegen bei den Aufwendungen für die Teilnahme des Sachverständigen Dr. W. an der mündlichen Verhandlung vom 2. Dezember 2022. Diese hat die Vorinstanz zu Unrecht nicht als erstattungsfähig angesehen. Denn die Beigeladene durfte sich aufgrund der damaligen Prozesslage herausgefordert sehen, dass sich ein mit dem Vorhaben vertrauten Sachverständiger des Ingenieurbüros G. in der mündlichen Verhandlung zu streitigen fachlichen Fragen äußert. Zwar hatte das Verwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 3. Juli 2020 im vorläufigen Rechtsschutzverfahren offengelassen, ob die von diesem Ingenieurbüro gefertigten Immissionsprognose vom 26. Juni 2019 überhaupt belastbar sei, weil selbst bei Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm sich nichts daran ändere, dass eine derartige Massierung von Stellplätzen in dem rückwärtigen Ruhebereich in der konkreten Örtlichkeit nicht sozialadäquat sei.
Auch der Senat war in seinem Beschluss vom 20. Oktober 2020 davon ausgegangen, dass die TA Lärm mit ihren Immissionsrichtwerten, dem Spitzenpegelkriterium und der von ihr definierten Vorbelastung bei der Beurteilung von Immissionen, die durch die Nutzung zugelassener notwendiger Stellplätze eines Wohnvorhabens verursacht werden, in der Regel keine Anwendung finde. Die Unzumutbarkeit der durch die Stellplätze entstehenden Lärmimmissionen für die Nachbarschaft hat das Verwaltungsgericht aber u.a. damit begründet, dass aufgrund der umliegenden Bebauung ein »Echoeffekt« eintrete.
Aufgrund der im Beschluss des Senats vom 20. Oktober 2020 dargelegten Rechtsauffassung und der vom Kläger in der Klagebegründung hiergegen erhobenen Einwände zu diesem Gesichtspunkt musste die Beigeladene damit rechnen, dass die – streitige – Frage, inwieweit der »Echoeffekt« bei der Berechnung der Lärmimmissionen berücksichtigt wurde, für die Entscheidung des Verwaltungsgerichts im Hauptsacheverfahren von Bedeutung sein könnte und ggf. der fachlichen Untermauerung in der mündlichen Verhandlung bedarf. Der Senat hatte in seinem Beschluss ausgeführt, der von der Beigeladenen beauftragte Sachverständige W. habe in seiner Stellungnahme von 14. Juli 2020 plausibel ausgeführt, dass der Hinweis auf einen eventuell vorhandenen »Echoeffekt« fachlich irrelevant sei.
In der Klagebegründung […] hat der Kläger diese Einschätzung angegriffen und beanstandet, die diesbezüglichen Ausführungen seien von derartiger Allgemeinheit, dass gerade nicht davon ausgegangen werden könne, dass die Besonderheiten des Einzelfalls Berücksichtigung gefunden hätten. Auch im Ortstermin am 13. Oktober 2022 hat der Kläger nochmals auf den »Echoeffekt« verwiesen. Darüber hinaus musste die Beigeladene davon ausgehen, dass die im Ortstermin angesprochene Frage, inwieweit die Verwendung schallabsorbierender Materialien bei der Errichtung der Carports und von »Flüstersteinen« bei der Pflasterung des Innenhofs zu einer relevanten Lärmminderung führt, möglicherweise der (weiteren) Erläuterung durch einen Sachverständigen bedarf. Denn diese Wirkungen hatte der Kläger im Ortstermin in Zweifel gezogen bzw. bestritten.
Im Hinblick auf die Vorbelastung streitig geblieben und daher aus der Sicht der Beigeladenen möglicherweise fachlich erläuterungsbedürftig war auch die Frage, inwieweit der ursprünglich vorhandene Baumbestand auf dem Grundstück eine schalldämmende Wirkung hatte. Dem diesbezüglichen Einwand des Klägers hat der Sachverständige P. entgegengehalten, dass der Bewuchs keine nennenswerte bzw. messbare Auswirkung auf die Schallausbreitung habe
Die Zurückverweisung der Rechtssache im Umfang der erfolgreichen Beschwerde an die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle beruht auf § 173 Satz 1 VwGO i.V.m. § 573 Abs. 1 Satz 3 und § 572 Abs. 3 ZPO.
[…]
OVG des Landes Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 07.05.2024, Az. 2 O 142/23
Als Premiumabonnent von »Bausachverständige« haben Sie Zugang zur Recherche in unserer Rechtsprechungsdatenbank.